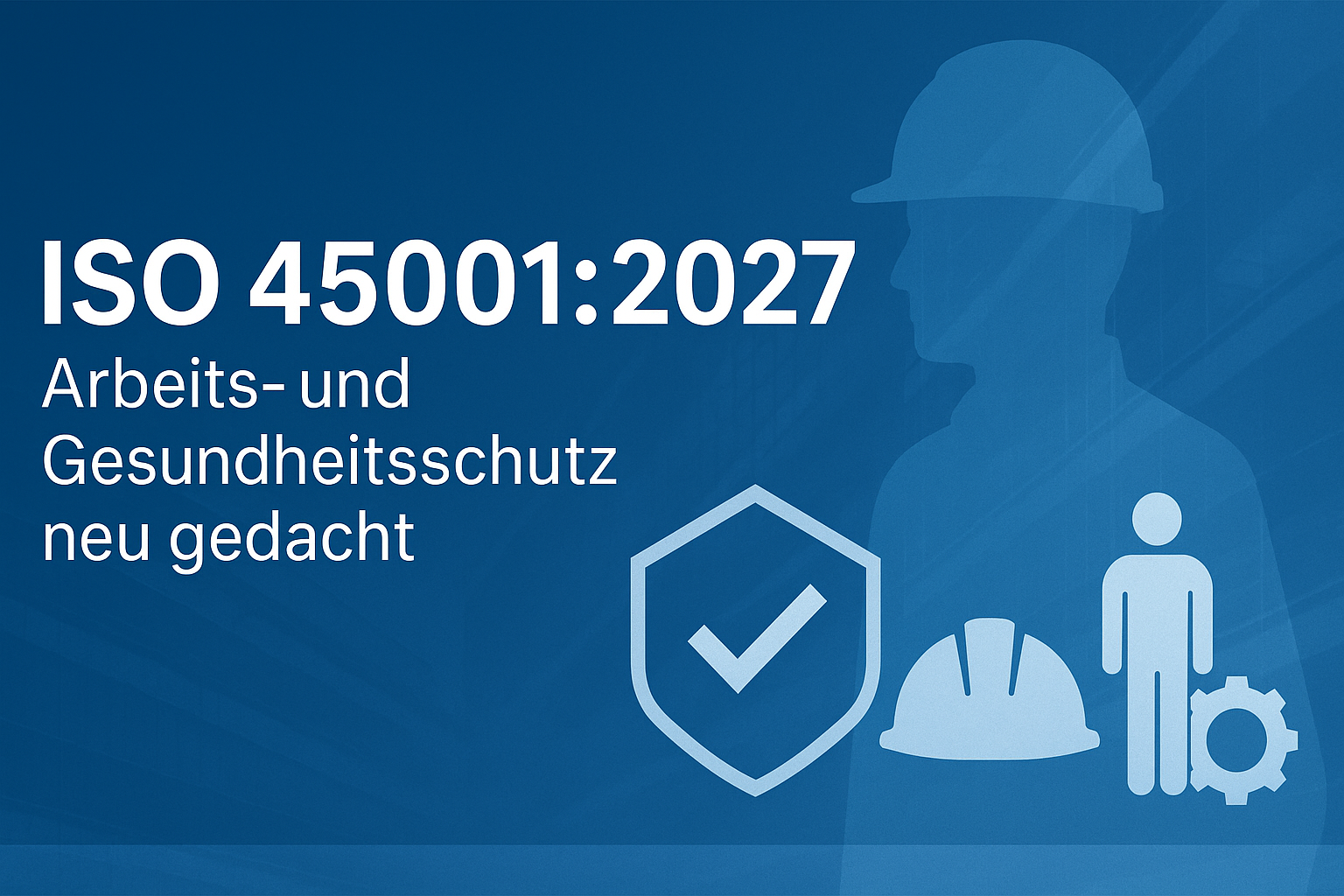
Die neue ISO 45001 – wohin entwickelt sich der Arbeits- und Gesundheitsschutz bis 2027?
Warum wird ISO 45001 überarbeitet?
ISO 45001:2018 hat sich seit ihrer Veröffentlichung zur weltweit zentralen Norm für Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA) entwickelt. Millionen Beschäftigte arbeiten heute in Organisationen, die sich an dieser Norm orientieren.
Wie alle ISO-Managementsystemnormen wird auch ISO 45001 in einem Fünf-Jahres-Rhythmus systematisch überprüft. Diese Revision wurde 2023 offiziell angestoßen; das zuständige ISO Technical Committee 283 (ISO/TC 283) hat die Überarbeitung bestätigt und in die Planungsphase überführt.
Wichtig für die Praxis:
-
Die Konzeption der Revision läuft seit 2024,
-
die Arbeiten werden voraussichtlich bis 2027 dauern,
-
die neue Ausgabe wird nach aktuellem Stand mit hoher Wahrscheinlichkeit als ISO 45001:2027 erscheinen – einige Informationsquellen sprechen von 2026/2027, die meisten Zertifizierer und Fachkreise gehen mittlerweile klar von 2027 aus.
Eine deutsche Fassung DIN EN ISO 45001:2023-12 existiert bereits, ändert jedoch inhaltlich kaum etwas – es handelt sich im Kern um eine redaktionelle Aktualisierung der Fassung von 2018.
Wer arbeitet woran?
Die Überarbeitung der Norm wird im ISO/TC 283 gesteuert. Dort sind verschiedene Arbeits- und Task-Groups eingerichtet, unter anderem:
-
WG 6 „Revision of ISO 45001“ – die zentrale Arbeitsgruppe für die inhaltliche Überarbeitung der Norm,
-
Arbeitsgruppen zu Klimawandel, Remote Work, Governance und Leadership, emerging themes in OH&S, psychosozialen Belastungen und kleinen Organisationen.
Diese Struktur zeigt bereits die Stoßrichtung: Die neue ISO 45001 wird deutlich stärker auf aktuelle Arbeitswelten, neue Risikofelder und moderne Führungs- und Governance-Anforderungen ausgerichtet sein.
Offizielle Aussagen von ISO, Zertifizierern und Fachgesellschaften betonen dabei übereinstimmend:
-
Der Revisionsprozess befindet sich noch in einem verhältnismäßig frühen Stadium,
-
eine Veröffentlichung der neuen Norm wird frühestens 2027 erwartet,
-
im Anschluss ist mit einer Übergangsfrist von etwa drei Jahren zu rechnen.
Konkrete Normtexte (Committee Draft, DIS) sind derzeit nicht öffentlich zugänglich. Aussagen zu Änderungen können daher nur den Charakter von „wahrscheinlichen Schwerpunkten“ haben – nicht von abschließend festgelegten Anforderungen.
Womit müssen Unternehmen rechnen?
Trotz des frühen Stadiums zeichnen sich zentrale inhaltliche Themenfelder ab, die in nahezu allen Fachbeiträgen, ISO-Informationen und Zertifizierer-Kommentaren wiederkehren:
Psychische Gesundheit, Wohlbefinden und psychosoziale Risiken
Ein deutliches Kernziel der Revision ist, psychische Gesundheit und Wohlbefinden („well-being“) wesentlich stärker in das Managementsystem zu integrieren.
ISO/TC 283 sowie Fachorganisationen wie die American Society of Safety Professionals berichten, dass Aspekte wie:
-
psychosoziale Gefährdungen (Stress, Arbeitsverdichtung, Mobbing, Konflikte),
-
mentale Gesundheit, Resilienz und Erholungsfähigkeit,
-
Diversity & Inclusion und eine wertschätzende Unternehmenskultur
in der neuen Fassung expliziter adressiert und im Kern der Norm verankert werden sollen.
Für Unternehmen bedeutet dies voraussichtlich:
-
systematischere Bewertung psychosozialer Risiken im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung,
-
stärkere Verknüpfung von Arbeits- und Gesundheitsschutz mit HR, Führungskräfteentwicklung und Organisationskultur,
-
mehr Fokus auf präventive Maßnahmen gegen Burn-out, Überlastung und psychische Erkrankungen.
Lieferkettenverantwortung und globale Arbeitsbedingungen
Mehrere Zertifizierungsorganisationen heben hervor, dass Verantwortung in der Lieferkette deutlich an Gewicht gewinnen wird.
Im Kontext von Lieferkettengesetzen, ESG-Berichterstattung und globalen Produktionsnetzwerken ist zu erwarten, dass Unternehmen:
-
ihre Anforderungen an Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz systematischer in Verträge, Audits und Bewertungskriterien gegenüber Lieferanten integrieren,
-
Risiken in ausgelagerten Prozessen (z. B. Logistik, Fremdfirmen, Outsourcing) transparenter erfassen und steuern,
-
das Thema „sichere Arbeit“ stärker mit Nachhaltigkeit und Menschenrechten verknüpfen.
Digitalisierung, Daten und neue Technologien
Die Revision von ISO 45001 soll außerdem Digitalisierung, Automatisierung und neue Technologien stärker berücksichtigen.
Dazu zählen voraussichtlich:
-
der Umgang mit neuen Gefährdungen durch autonome Systeme, kollaborative Roboter, KI-gestützte Anwendungen und vernetzte Anlagen,
-
der systematische Einsatz von Daten (z. B. Near-Miss-Analysen, Wearables, Sensorik, Echtzeit-Monitoring) zur Risikobewertung und Erfolgskontrolle,
-
Anforderungen an Datenschutz, Akzeptanz und Beteiligung der Beschäftigten bei digitalisierten SGA-Prozessen.
Klimawandel, Nachhaltigkeit und externe Rahmenbedingungen
ISO/TC 283 hat eigene Arbeitsgruppen zu Klimawandel und SGA-Risiken eingerichtet.
Daher ist davon auszugehen, dass die neue ISO 45001:
-
klimabedingte Risiken (Hitze, Extremwetter, Luftqualität, Notfallmanagement) stärker adressiert,
-
Schnittstellen zum Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement (z. B. ISO 14001, ESG) deutlicher beschreibt,
-
die Resilienz von Organisationen gegenüber sich verändernden Rahmenbedingungen betont.
Governance, Leadership und Kultur
Mehrere Arbeitsgruppen des TC 283 fokussieren explizit Governance und Leadership, inklusive der Rolle von Top-Management und Aufsichtsgremien.
Mögliche Schwerpunkte:
-
klarere Anforderungen an Verantwortlichkeiten und Berichtslinien,
-
stärkere Verankerung von SGA-Zielen in Strategie, Risikomanagement und Compliance,
-
messbare Anforderungen an Führungsverhalten, Beteiligung, Kommunikation und Lernkultur.
Struktur der Norm: Anpassungen innerhalb der High Level Structure
ISO 45001 folgt bereits heute der einheitlichen Grundstruktur für Managementsysteme (Annex SL/„Harmonized Structure“). Es ist zu erwarten, dass die neue Fassung:
-
strukturell kompatibel zu künftigen Ausgaben von ISO 9001 und ISO 14001 bleibt,
-
Begrifflichkeiten und Definitionen harmonisiert und vereinfacht,
-
Redundanzen reduziert und den Fokus auf Wirksamkeit legt – weniger „Papier“, mehr gelebte Praxis.
Mehrere Quellen betonen, dass es ausdrücklich um „mehr Integration, weniger Bürokratie“ gehen soll, bei gleichzeitig höherem Anspruch an Wirksamkeit und nachweisbare Ergebnisse.
Auswirkungen auf Unternehmen: Was bedeutet die Revision konkret?
Auch wenn die finalen Normtexte noch nicht vorliegen, lassen sich die absehbaren Konsequenzen grob skizzieren:
-
Breitere Perspektive auf Gesundheit und Sicherheit
-
Von rein physischer Sicherheit hin zu einem umfassenden Verständnis von „Health & Wellbeing“.
-
Stärkere Schnittstelle zu HR, Organisationsentwicklung und psychischer Gefährdungsbeurteilung.
-
-
Mehr Fokus auf Wertschöpfung und Risiko – weniger Formalismus
-
Prozesse, Kennzahlen und Maßnahmen werden stärker an Wirkungen geknüpft: Unfallvermeidung, Gesundheitsquote, Kulturindikatoren.
-
Dokumentation bleibt wichtig, steht aber nicht mehr im Mittelpunkt, sondern die tatsächliche Performance des Systems.
-
-
Erweiterter Geltungsbereich in Lieferketten
-
Unternehmen müssen SGA-Anforderungen systematischer entlang der Wertschöpfungskette denken – insbesondere mit Blick auf rechtliche Rahmen wie Lieferkettengesetze und ESG-Reporting.
-
-
Komplexere, aber auch wirkungsvollere Rolle der Führungskräfte
-
Top-Management und mittlere Führungsebenen werden stärker in die Pflicht genommen, Vorbilder zu sein, Ressourcen bereitzustellen und Kultur aktiv zu gestalten.
-
-
Übergangsfristen und Zertifizierung
-
Nach Veröffentlichung von ISO 45001:2027 ist eine Übergangsfrist von rund drei Jahren wahrscheinlich.
-
In dieser Zeit müssen bestehende Managementsysteme an die neue Norm angepasst und erfolgreich rezertifiziert werden.
-
Wie können sich Unternehmen jetzt schon vorbereiten?
Auch ohne finalen Normtext können Organisationen bereits zielgerichtet vorarbeiten. Sinnvolle Schritte sind:
-
Statusanalyse des bestehenden SGA-Managementsystems
-
Wie gut sind psychische Gesundheit, Wohlbefinden und psychosoziale Risiken bereits integriert?
-
Wie konsequent werden Lieferkettenpartner in SGA-Prozesse einbezogen?
-
Welche Kennzahlen nutzt das Unternehmen, um Wirksamkeit und Kultur zu messen?
-
-
Frühzeitige Einbindung von HR, Compliance, Nachhaltigkeit und Einkauf
-
Interdisziplinäre Teams bilden, um Themen wie Wellbeing, Lieferkette und ESG nicht isoliert zu betrachten, sondern vernetzt.
-
-
Digitalisierung gezielt nutzen
-
Bestehende Datenquellen (Unfallstatistik, Beinahe-Ereignisse, Gefährdungsbeurteilungen, Mitarbeiterbefragungen) aufbereiten und für ein besseres Verständnis von Risiken und Trends nutzen.
-
Prüfen, wo Sensorik, digitale Meldewege oder E-Learning den SGA-Prozess unterstützen können.
-
-
Führung & Kultur in den Mittelpunkt stellen
-
Führungskräfte zu moderner Sicherheitskultur, psychischer Gesundheit und beteiligungsorientierter Kommunikation qualifizieren.
-
Ein Umfeld schaffen, in dem das Melden von Unsicherheiten, Fehlern und Beinahe-Unfällen ausdrücklich erwünscht ist.
-
-
Normungs- und Fachinformationen aktiv verfolgen
-
Informationen des ISO/TC 283, nationaler Normungsorganisationen und akkreditierter Zertifizierungsstellen regelmäßig prüfen.
-
ISO 45001 wird moderner, integrierter und anspruchsvoller
Auch wenn die Bezeichnung „ISO 45001:2026“ in einigen Veröffentlichungen auftaucht, deutet der heutige Stand klar darauf hin, dass die nächste Ausgabe als ISO 45001:2027 erscheinen wird. Inhaltlich geht es nicht um kosmetische Korrekturen, sondern um eine substantielle Weiterentwicklung des Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagements:
-
mehr Gewicht für psychische Gesundheit und Wohlbefinden,
-
stärkere Verantwortung für sichere Arbeitsbedingungen in der Lieferkette,
-
engere Verknüpfung mit Digitalisierung, Klimarisiken und Nachhaltigkeit,
-
höhere Anforderungen an Führung, Governance und Sicherheitskultur.
Für Unternehmen, die ISO 45001 bereits implementiert haben, ist das eine Herausforderung – aber auch eine Chance: Wer sich frühzeitig mit den absehbaren Themen beschäftigt, kann sein SGA-Managementsystem nicht nur rechtzeitig anpassen, sondern es strategisch weiterentwickeln und als starken Hebel für Resilienz, Arbeitgeberattraktivität und nachhaltigen Unternehmenserfolg nutzen.
